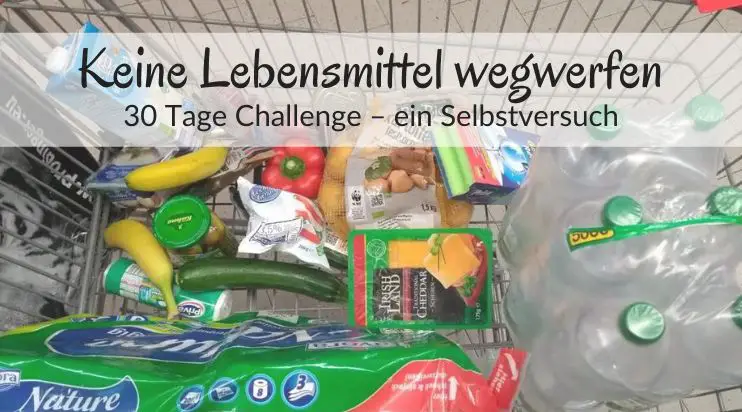Die Wut, die bleibt [Rezension] – Ein aufwühlender Roman über Care Arbeit und Wut
„Haben wir kein Salz.“ – Dieser eine Satz, diese implizite Kritik und Aufforderung noch einmal aufzustehen, ist der Tropfen, der für Helene, Mutter von drei Kindern, inmitten der Pandemiezeit das Fass zum Überlaufen bringt. Sie steht wortlos auf. Öffnet die Balkontür. Macht drei Schritte nach vorn und lässt sich 12 Meter in die Tiefe fallen.
Mit dieser starken Einstiegsszene, die zumindest bei mir noch lange nachwirkte, beginnt Mareike Fallwickl Roman „Die Wut, die bleibt“*.
Wut habe ich während des Lesens gleich mehrfach gespürt. Denn die Autorin beschreibt sehr treffend, wie Gleichberechtigung in der Realität wirklich aussieht. Wie das mit dem Mental Load wirklich ist und wie unterschiedlich doch ein und dieselben Gegebenheiten bei Müttern und Vätern gewertet werden. Erfahrungen, die ich in meinen vergangenen 3 Jahren als Mutter unzählige Male machen durfte.
Der Roman überschreitet aber auch Grenzen, zeigt die hart es wirklich sein kann, eine Frau zu sein und ist an manchen Stellen nur schwer zu ertragen.
„Die Wut, die bleibt“ – Eine kurze Zusammenfassung
Nach Helenes Suizid sind ihre Familie und ihre beste Freundin Sarah schockiert. Inmitten der Pandemie fehlt nicht nur ein Familienmitglied, sondern die zentrale Figur, die sich um alles gekümmert hat.
Während Witwer Johannes bald schon beginnt, wieder seiner Arbeit nachzugehen. Ist es für ihn erschreckend selbstverständlich, dass sich zunächst seine betagte Mutter und dann Helenes beste Freundin Sarah um die Kinder und den Haushalt kümmern.
Als Sarah bei Johannes einzieht, erlebt sie hautnah die überwältigende Last des Familienalltags. Sie sieht, wie wenig Johannes sich verantwortlich fühlt und wie sehr die Care Arbeit sie an ihre Grenzen bringt. Zudem wird ihr klar, wie selbstverständlich von Frauen erwartet wird, diese Aufgaben zu übernehmen – ohne Rücksicht auf ihre eigenen Bedürfnisse. Sarah beginnt zu hinterfragen, wie viel sie geben kann, ohne sich dabei selbst zu verlieren.
Für Lola, Helenes 15-jährige Tochter aus einer vorherigen Beziehung, wird der Verlust ihrer Mutter zum Wendepunkt. Zunächst äußert sich ihre Trauer in Essstörungen und Selbstverletzungen. Doch aus dem Schmerz erwächst eine wachsende Wut auf das patriarchale System. Sie rebelliert gegen gesellschaftliche Normen, lehnt sich gegen Rollenklischees auf und lässt sich nicht länger über ihren Körper definieren. Ihre Wut richtet sich zunehmend auch gegen Männer, wobei sie zu Gewalt greift.
![Die Wut, die bleibt [Rezension] – Ein aufwühlender Roman über Care Arbeit und Wut 3 Die Wut die bleibt 3 Vorder- und Rückseite des Romans 'Die Wut, die bleibt' von Mareike Fallwickl, Fokus auf Coverdesign und Buchrückentext.](https://denise-bucketlist.de/wp-content/uploads/2024/12/Die-Wut_-die-bleibt-3.webp)
Mareike Fallwickl über ihren Roman: „Dies ist ein intensiver und emotional herausfordernder Roman, der aufwühlende Fragen stellt und vor dem Hintergrund einer Pandemie spielt, die uns alle an Grenzen der Belastbarkeit bringt.“ – Mareike Fallwickl: Die Wut, die bleibt. Hamburg: Rowohlt Verlag 2024, 8. Auflage, Nachbemerkung, S. 379.
Die beiden Hauptfiguren: Sarah und Lola
Nach Helenes Suizid wird die Geschichte aus zwei Perspektiven erzählt: Sarah, Helenes beste Freundin, und Lola, Helenes 15-jährige Tochter. Beide stehen für unterschiedliche Generationen und Lebensentwürfe, doch beide kämpfen mit den Auswirkungen von Helenes plötzlichem Tod.
Helenes beste Freundin Sarah (40)
Sarah ist Helenes beste Freundin seit Kindertagen und eine erfolgreiche Autorin. Sie lebt mit ihrem jüngeren Freund Leon in einem großen Haus. Während sie sich nach Familie und Verbindlichkeit sehnt, zeigt er wenig Interesse daran. Sarah repräsentiert eine typische Millennial-Frau: beruflich erfolgreich, aber in Beziehungen zurückhaltend, oft aus mangelndem Selbstwertgefühl. Sie steht im Kontrast zu Helene, die nach Heirat und Kindern in traditionelle Rollen zurückfiel.
Helenes älteste Tochter Lola (15)
Lola repräsentiert die Generation Z. Sie interessiert sich für Feminismus, gendert bewusst und möchte sich selbst verteidigen können. Ihre Mutter und Sarah erscheinen ihr zu passiv und kompromissbereit. Frauen, die studiert haben und alle Möglichkeiten hatten, sich aber dennoch in traditionelle Rollen fügen. Sie sieht sie als Frauen, die ihrem Mann das Abendessen bereiten, sich für ihn zurechtmachen und selbst in privaten Momenten um Perfektion bemüht sind – bis sie irgendwann daran zerbrechen.
Lola sieht sogar Gewalt als legitimes Mittel, um sich gegen Männer zu wehren. Nach dem Tod ihrer Mutter ist sie emotional am Boden und kanalisiert ihre Wut, indem sie Halt in einer Girl-Gang sucht.
![Die Wut, die bleibt [Rezension] – Ein aufwühlender Roman über Care Arbeit und Wut 4 Die Wut die bleibt 1 Roman 'Die Wut, die bleibt' von Mareike Fallwickl als Hardcover-Ausgabe, dekorativ in einem beleuchteten Weihnachtsbaum platziert.](https://denise-bucketlist.de/wp-content/uploads/2024/12/Die-Wut_-die-bleibt-1.webp)
Johannes & Leon: Darstellung von Männern
Johannes zeigt nach Helenes Tod kaum Initiative, sich aktiv um seine Familie zu kümmern. Stattdessen delegiert er die Verantwortung für den Haushalt und die Kinder erst an seine Mutter und später an Sarah. Er hinterfragt weder die Dynamiken, die zu Helenes Verzweiflung geführt haben, noch seine eigene Rolle darin. Insgesamt wird die Figur als emotional distanziert und unsensibel beschrieben und insgesamt in keinem schmeichelhaften Licht dargestellt.
Auch Sarahs Freund Leon kommt nicht gut weg. Er lebt zwar bei Sarah, scheint aber keinerlei Verantwortung übernehmen oder eine ernsthafte Beziehung eingehen zu wollen. Im Roman nimmt er die Rolle des selbstgefälligen, unverbindliche jüngere Partners, der Sarahs Sehnsüchte hervorhebt.
Insgesamt finde ich insbesondere Johannes Darstellung überspitzt. Auch wenn die Aufteilung der Care Arbeit wohl in vielen Familien so aussieht, wie bei Helene und Johannes, finde ich Johannes Verhalten nach Helenes Tod unrealistisch.
Immerhin ist seine Frau gestorben und seine beiden kleinen Kinder haben ihre Mutter verloren. Karriere hin oder her? Aber geht man in dieser Situation bereits direkt nach der Beerdigung wieder arbeiten und überlässt seine traumatisierten Kinder einer Frau, die sie pandemiebedingt kaum kennen? Es wäre interessant gewesen, auch etwas vom Innenleben der beiden Männer mitzubekommen. So wirken beide in ihrem Verhalten sehr extrem.
Aber vielleicht sind es genau diese fehlenden Grautöne, mit denen der Roman seine Wirkung erzielt. Nämlich Wut auf Patriarchat, das System und die Selbstverständlichkeit mit den Frauen zurückstecken.
![Die Wut, die bleibt [Rezension] – Ein aufwühlender Roman über Care Arbeit und Wut 5 Die Wut die bleibt 2 Buch 'Die Wut, die bleibt' von Mareike Fallwickl neben einer blauen Tasse mit heißem Tee auf weißem Hintergrund.](https://denise-bucketlist.de/wp-content/uploads/2024/12/Die-Wut_-die-bleibt-2.webp)
Wie viel Realität steckt in dem Roman? – Meine Erfahrungen als Mutter
Hätte ich diesen Roman vor einigen Jahren gelesen, als ich noch nicht Mutter war, hätte ich einiges mit Sicherheit übertrieben gefunden. Mittlerweile habe ich erleben dürfen – wenn auch nicht in unserer kleinen Familie – dass erschreckend oft genauso läuft.
Während Männer und Frauen theoretisch gleichberechtigt sind, fängt es mit der ungleichen Behandlung nämlich zügig an. Noch lange, bevor das erste Kind da ist.
So habe bei einem ehemaligen Arbeitgeber mitbekommen, dass Bewerbungen von verheiraten Frauen Ende 20 kritisch beäugt wurden („Die ist ja dann ohnehin bald weg“). Während dies bei gleichaltrigen, verheirateten Männern kein Problem war. Selbst als wir noch kinderlos waren, gingen einige Freunde selbstverständlich davon aus, dass bei Einladungen zu uns nach Hause für das Essen zuständig war.
Als wir dann nach der Geburt unseres Sohnes begonnen haben, beide zeitversetzt in Teilzeit zu arbeiten, wurde mein Mann hierfür ungläubig gefeiert, während ich mir ein kritisches „Ich könnte, das ja nicht“ anhören musste. Als mein Mann mit unserem Sohn (Samstagvormittag!) zur Spielgruppe ging, wurde er von den anderen Müttern besorgt gefragt, ob seine Frau krank sei. Kinderarzt und Kindergarten rufen ausschließlich mich bei der Arbeit an, schließlich wolle man meinen Mann ja nicht bei der Arbeit stören. An dieser Stelle könnte ich unzählige Beispiele aufzählen, wie ein und derselbe Sachverhalt bei uns als Vater und Mutter anders bewertet wird.
Besonders erschreckend sind für mich aber auch die Aussagen anderer Mütter. Hängen geblieben ist bei mir Aussage einer Arbeitskollegin, dass ausschließlich sie bei kindkrank oder Schließtagen einspringt, da der Job ihres Mannes ja wichtiger sei. Er konnte aber auch nur karrieretechnisch an ihr vorbeiziehen, da sie jahrelang in Elternzeit war und auch danach nie wieder Vollzeit gearbeitet hat. Ich kenne auch ausschließlich Mütter, die aufgrund ständiger Notbetreuung ihre Arbeit verloren haben.
Auch wenn mein Sohn bereits zum Ende der Pandemie hin geboren wurde, kann ich mir vorstellen, dass Corona diesen Missstand noch einmal verschärft hat. Daher kann ich sagen: auch wenn es in den allermeisten Familien nicht so extrem wie bei Helene und Johannes ist, beschreibt der Roman ein in vielen Familien realistisches Bild. Ich bin überzeugt. dass „Die Wut, die bleibt*“ gerade für Männer, die vieles noch als selbstverständlich nehmen, zum Augenöffner werden könnte.
Die Lösung? – Gewalt gegen Gewalt
Kann Gewalt ein legitimes Mittel sein, um sich gegen patriarchale Unterdrückung und gesellschaftliche Ungerechtigkeit zu wehren?
Diese Frage spiegelt sich vor allem in der Entwicklung von Lola wider, die aus ihrer Wut heraus Gewalt als Form der Selbstermächtigung und des Widerstands betrachtet.
Für mich lautet die Antwort definitiv: Nein! Die entsprechenden, sehr detaillierte beschriebenen Szenen im Buch fand ich schwer zu lesen. Einige Passagen habe ich sogar komplett übersprungen.
Jedoch kann ich die Wut nachvollziehen, die dazu führt. Der Roman zeigt, wie Frauen sich zu radikalen Handlungen greifen, wenn sie sich von friedlichen Lösungen verlassen fühlen. Gewalt wird hier als Symbol für die Rebellion gegen traditionelle Rollen und Normen dargestellt – als verzweifelter Versuch, sich gegen ein System zu behaupten, das auf Unterdrückung und Ungerechtigkeit basiert.
Ein gefährlicher und moralisch fragwürdiger Ansatz, der aber auch die Frage aufwirft, wie denn ein friedlicher Weg aussehen könnte.
Ein schwaches Ende?
Das Ende möchte ich an dieser Stelle selbstverständlich nicht verraten. Nur so viel: Während ein Handlungsstrang für mich vorausschaubar war, ist der andere für mich enttäuschend.
Zum einen ist es für mich ein wenig realitätsfern. Zum anderen hätte ich mir für die Figur einen anderen Weg gewünscht, mit ihrer Wut und ihrem Anliegen umzugehen.
Dennoch gebe ich für „Die Wut, die bleibt“ eine klare Leseempfehlung. Der Roman wühlt auf, regt zum Nachdenken an und zeigt sehr eindringlich gesellschaftliche Probleme auf. Über vieles lässt sich diskutieren und das ist gut so.
Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf einen solchen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekomme ich von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Denise Ni
Bucket Listerin, Online-Marketing-Enthusiastin und Neu-Mama
Seit 2017 ist Denise begeisterte Bucketlisterin. Auf ihrem Blog berichtet sie in über 130 Beiträgen von ihren eigenen Erlebnissen. Überdies unterstützt sie ihre Leserschaft dabei, eine eigene Bucket List zu erstellen, Bucket List Ideen zu finden und die eigenen Ziele zu erreichen.
Ihre Begeisterung für das Thema spiegelt sich auch in ihren drei Büchern wider, die sie zusammen mit dem Remote Verlag veröffentlichte. Als Bucket List-Expertin war sie bereits zu Gast im SWR 2 Radio und weiteren Print- und Onlinemedien (Über Mich).

![Die Wut, die bleibt [Rezension] – Ein aufwühlender Roman über Care Arbeit und Wut 2 Die Wut die bleibt 2 1 Rezension von "Die Wut, die bleibt" von Mareike Fallwickl](https://denise-bucketlist.de/wp-content/uploads/2024/12/Die-Wut_-die-bleibt-2-1.webp)